Die BIZ und das Monstrum - und warum den Zentralbanken die Hände gebunden sind
27.11.2007 | Dr. Bruno Bandulet
Wer sich über den Zustand der Weltwirtschaft und des Weltfinanzsystems zuverlässig informieren möchte, findet kaum eine bessere Quelle als den Jahresbericht der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich. Im Juni erschien er zum 77. Mal - 252 Seiten voller Zahlen, Fakten und Meinungen, die nach Art von Zentralbankiers dezent und diplomatisch vorgebracht werden. Schließlich fungiert die in Basel domizilierte BIZ als Bank der Zentralbanken. Sie weiß sehr viel, kann aber nicht alles sagen. Wenn sie immer wieder von "Ungleichgewichten" spricht, meint sie in Wirklichkeit hochgefährliche Schieflagen, die zwar immer noch in einer prekären Balance gehalten werden, die aber nicht von Dauer sein können.
Die größte aller Schieflagen ist das amerikanische Leistungsbilanzdefizit, das bisher nur deswegen nicht zu einem unkontrollierten Dollar-Crash geführt hat, weil es auf Grund der "Erwartung einer sehr begrenzten Abwertung des Dollars" (so die BIZ) nach wie vor vom Rest der Welt finanziert wird. Insgesamt ergibt sich aus dem BIZ-Bericht das Bild eines Monstrums - eines durch ständige Geldvermehrung und Schuldenausweitung gestützten und hochgradig fragilen Finanzsystems. Im einzelnen:
1. Die Leistungsbilanzen
2006 verharrte das Außendefizit der USA bei 6,5% des Bruttoinlandsproduktes - ein historischer Spitzenwert, der die amerikanischen Defizite der siebziger Jahre, als der Dollar abstürzte, bei weitem übersteigt. Dementsprechend groß sind die Leistungsbilanzüberschüsse Chinas (9,1% BIP), Japans (3,9% BIP) und übrigens auch Rußlands (9,8% BIP). Es ist ein paradoxer und geschichtlich einmaliger Zustand, daß die führende Wirtschafts- und Militärmacht nicht etwa den Gläubiger der Welt spielt (wie zuletzt England), sondern sich von Ländern aushalten läßt, von denen manche, wie z.B. China, immer noch Entwicklungshilfe beziehen, jedenfalls aus Deutschland. Auch 2006 lag die Sparquote der Chinesen auf Rekordniveau, auch 2006 war sie in den USA negativ. Mit anderen Worten: der amerikanische Verbraucher ist heillos überschuldet, er bildet die Achillesferse der Weltkonjunktur.
Der Euro-Raum ist 2006 leicht ins Minus gerückt. Die deutschen Überschüsse im Außenhandel können die Leistungsbilanzdefizite der anderen Euro-Länder nicht mehr ganz kompensieren. Würde Deutschland zur D-Mark zurückkehren, wäre der Euro umgehend eine Schwachwährung. Wahrscheinlich kann sich der Dollar auch deswegen (bisher) leidlich halten, weil der Euro keine wirklich überzeugende Alternative darstellt. Es ist nicht einmal sicher, ob er auf Dauer Bestand hat. Auf absehbare Zeit freilich gilt, daß eine Finanzkrise oder ein Aktiencrash nicht von Europa, sondern von den USA oder allenfalls von China ausgehen würde.
Ein anderer wichtiger Punkt: Im Falle einer neuen Krise an den Währungsmärkten werden kleinere Länder mit hohen Leistungsbilanzdefiziten besonders betroffen sein. Beispiele dafür sind Südafrika und die Türkei. Verblüffend war 2006 und 2007 der Gleichlauf zwischen Wechselkurs und Ölpreisen bei den Energieproduzenten Norwegen und Kanada. Die beiden Währungen folgten dem Ölpreis erst nach unten, dann nach oben.
2. Der Wert der Währungen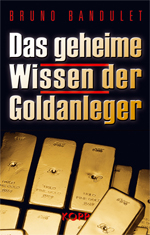 Seit dem Ende der Goldbindung sind die Währungen eigentlich nie korrekt bewertet. Sie bewegen sich statt dessen einmal in Richtung Unterbewertung, ein andermal in Richtung Überbewertung. Ist der US-Dollar jetzt schon stark unterbewertet? Laut BIZ: Nein. Gemessen am Durchschnitt der realen effektiven Wechselkurse im Zeitraum Januar 1973 bis April 2007 (also unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Inflation) war der Dollar in den Monaten seit Jahresanfang 2007 um 7% zu billig, der Euro etwa um 7% zu teuer. Das war keine besonders krasse Abweichung vom Durchschnitt.
Seit dem Ende der Goldbindung sind die Währungen eigentlich nie korrekt bewertet. Sie bewegen sich statt dessen einmal in Richtung Unterbewertung, ein andermal in Richtung Überbewertung. Ist der US-Dollar jetzt schon stark unterbewertet? Laut BIZ: Nein. Gemessen am Durchschnitt der realen effektiven Wechselkurse im Zeitraum Januar 1973 bis April 2007 (also unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Inflation) war der Dollar in den Monaten seit Jahresanfang 2007 um 7% zu billig, der Euro etwa um 7% zu teuer. Das war keine besonders krasse Abweichung vom Durchschnitt.
Stark unterbewertet um bis zu 20% sind hingegen der Japanische Yen, die Schwedische Krone und der Taiwan-Dollar. Der Singapur-Dollar ist immerhin um mehr als 10% unterbewertet. Am anderen Ende der Skala finden wir mit dem Neuseeland-Dollar und dem Britischen Pfund zwei deutlich überbewertete Währungen, die allein deswegen mit Vorsicht zu genießen sind - jedenfalls auf längere Sicht. In der Nordsee fällt die britische Ölproduktion. Wie steht England da, wenn die Quellen erschöpft sind?
3. Die Devisenreserven
Die Höhe der Währungsreserven ist ein wichtiger Maßstab für die internationale Liquidität (vulgo: Geldschwemme) und übrigens auch ein wichtiger Faktor für den Goldpreis. Die Goldhausse der letzten Jahre wäre ohne die schier unglaubliche Aufblähung der Devisenreserven schwer vorstellbar gewesen. Noch 2001 wuchsen sie um bescheidene 113,2 Milliarden Dollar, 2006 aber um 859,8 Milliarden auf einen Höchststand von 5034,2 Milliarden.
Winzig sind die Reserven der USA mit lediglich 40,9 Milliarden. Womit wollen sie im Ernstfall den Dollar verteidigen? Mit den mehr als 8.000 Tonnen Gold, die in den 40 Milliarden nicht enthalten sind? Den Fehler werden sie nicht machen.
Andere Frage: Was tun die Asiaten mit ihren riesigen Reserven? Sie benötigen sie nicht in dieser Höhe. Die chinesischen Währungsreserven reichen laut BIZ aus, um 16 Monate lang die Importe zu bezahlen, die Rußlands sogar für 20 Monate. Zum Vergleich: die Devisenreserven der Industrieländer reichen nur für einen Monat.
4. Das Risiko China
Wie stabil das chinesische Wirtschaftswunder wirklich ist, können wir nicht beurteilen. Dafür ist im Reich der Mitte zuviel undurchsichtig. (Wer eine sehr negative Einschätzung der Aussichten Chinas lesen möchte, sollte sich unbedingt das spannende Buch des China-Kenners Albrecht Rothacher besorgen: Mythos Asien? Licht- und Schattenseiten einer Region im Aufbruch, broschiert, 400 Seiten, Olzog Verlag, München 2007, 29,90 €.)
Der BIZ-Bericht läßt zumindest die Möglichkeit offen, daß China eine unangenehme Überraschung bereithält. Auf mittlere Sicht, d.h. mit Blick auf die nächsten Jahre, stelle sich die Frage, "ob das schnelle Wirtschaftswachstum Chinas und seine Nachfrage nach importierten Rohstoffen und Zwischenerzeugnissen auf Dauer aufrechtzuerhalten sind".
Schwachstelle 1: Im chinesischen Investitionsboom werden auch Projekte "mit geringer oder negativer Rendite" realisiert - eine Überinvestition ähnlich wie die in Ostasien vor der verheerenden Krise von 1997/1998. Das Produktivitätsniveau der Staatsunternehmen liegt etwa um 30% tiefer als das der privaten Konzerne. Dazu die BIZ: "Je länger solche Fehlallokationen von Ressourcen geduldet werden, desto schwerwiegender werden schließlich die Konsequenzen sein."
Schwachstelle 2: Ein "beträchtlicher Teil" der von den Banken vergebenen Kredite könnte notleidend werden, wenn sich die Konjunktur abkühlt. Die Risiken der Banken sind nämlich in den wenig rentablen Betrieben konzentriert. Rund 40% der staatlichen Industrieunternehmen arbeiten mit Verlust.
Schwachstelle 3: Eine US-Rezession würde die chinesischen Exporte und damit das Wirtschaftswachstum treffen - und indirekt z.B. auch Korea, weil China dann weniger aus Korea (und aus anderen asiatischen Ländern) importiert. Fazit: Für Anleger an den Rohstoffmärkten ist es ein Muß, die Entwicklung in China zu beobachten. G&M tut das kontinuierlich. Ein Einbruch in China, auf den derzeit nichts hindeutet, würde die Preise vieler Rohstoffe, von denen uns besonders Nickel gefährdet erscheint, hart treffen.
5. Der Kreditzyklus
Zurück zu den USA, die das Hauptrisiko für die Weltwirtschaft darstellen. "Früher oder später", meint die BIZ, "wird es zu einer Wende im Kreditzyklus kommen, und die Ausfallquoten werden zu steigen beginnen". So kann man eine Welle von Pleiten auch beschreiben. Im Sektor Immobilienfinanzierung hat der Prozeß bereits begonnen. Erst im Juni mußte die Investmentbank Bear Stearns 3,2 Milliarden Dollar bereitstellen, um den Kollaps zweier Hedge-Fonds abzuwenden. Es drohten Panikverkäufe mit unabsehbaren Folgen für die Finanzmärkte. Die Geldspritze soll es den Fonds ermöglichen, ihre Positionen geregelt abzuwickeln, d.h. zu verkaufen. Auch hier wieder das Problem eines extrem hohen Kreditanteils an den Geschäften! Auch die Großbank UBS hatte Schwierigkeiten mit einem ihrer Hedge-Fonds. Sie mußte Mittel einschießen, der Vorgang konnte unter den Teppich gekehrt werden.
Ohne Zweifel beginnt das Risiko eines Umfalls an den Kreditmärkten zu wachsen (siehe dazu auch das letzte G&M zum Thema CDO’s auf Seite 1). Die BIZ weist in diesem Zusammenhang auf einen besonders wichtigen Faktor hin: eine drohende Verschlechterung der Unternehmensrentabilität in den USA. Dies könne eine "Neubewertung der Kreditrisiken" auslösen. Tatsächlich hat sich das Wachstum der Unternehmensgewinne in den USA Ende 2006/Anfang 2007 bereits erheblich verlangsamt.
Schließlich zwei Indizien dafür, daß wir nicht unbedingt das Ende, aber doch die Endphase der Hausse bereits erreicht haben: die Eigentümer der Hedge-Fonds beginnen Kasse zu machen, indem sie an die Börse gehen und das Geld der Neuaktionäre einstreichen; und, zweitens, die immer noch andauernden, meist teuer bezahlten Übernahmen, die zum Teil fremdfinanziert werden und damit die Bonität der übernommenen Firmen verschlechtern.
Daß die Geldmaschine der Hedge-Fonds, der Haupttreiber der Finanzblase, bereits stottert, veranschaulicht die BIZ mit einer Grafik von deren Renditen. Diese sind zuletzt auf ein Drittel des Höchststandes von 2000 zurückgefallen! Die Zwischenerholung, die 2003 mit dem Anstieg der Aktienmärkte einsetzte, endete bereits 2006. Mit anderen Worten: Es wird immer mühsamer, Geld aus dem System herauszuquetschen. Die BIZ erinnert daran, wie "fragil" die Finanzstrategie der Hedge-Fonds sein kann und stellt ominös die Frage in den Raum, "ob die Hedge-Fonds in einem schwierigeren Marktumfeld bestehen können".
Klartext von Professor Issing
Ungleich deutlicher als die BIZ äußerte sich Professor Otmar Issing, der frühere Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank, in einem Interview mit der FAZ vom 14. Juni:
- "Das gegenwärtige Übergangsstadium weltweit (damit meint er die sogenannten Ungleichgewichte im Finanzsystem, G&M) hält jedoch schon zu lange an." Als ein Beispiel erwähnt Issing die Fremdwährungsanlagen japanischer Haushalte. "Hier hat sich ein großes Risikopotential aufgebaut."
- Issing läßt keinen Zweifel an der Existenz einer großen Finanzblase. "Das Finanzvermögen wächst viel rascher als das Sozialprodukt." Und dann seine Warnung: "Zahlreiche Studien aus BIZ und EZB belegen: Es hat kaum eine größere Blase in den Vermögenspreisen gegeben, die nicht von einer starken Ausdehnung der Geld- und/oder Kreditmenge begleitet war. Wenn aber eine große Blase platzt, ist das sozusagen der GAU der Makroökonomie."
- Professor Issing muß zugeben, daß die Notenbanken ohnmächtig sind: "Ich kenne keine Patentlösung." Jetzt noch einzuschreiten, verbietet sich seiner Meinung nach. Das nun folgende Issing-Zitat sollten Sie zweimal lesen: "Einverständnis (er meint: zwischen den Notenbanken, G&M) herrscht auch darüber, daß Notenbanken nicht versuchen sollten, eine spekulative Vermögenspreisblase zum Platzen zu bringen. Wenn eine große Blase platzt, bedeutet dies eine gesamtwirtschaftliche Krise allergrößten Ausmaßes. Keine Notenbank der Welt wird dafür die Verantwortung tragen wollen. Unstrittig ist ferner: Wenn eine spekulative Blase platzt, müssen Notenbanken Liquidität zur Verfügung stellen, um den gesamtwirtschaftlichen Kollaps zu verhindern."
© Bruno Bandulet
Quelle: Auszug aus Börsenbrief: GOLD&MONEY INTELLIGENCE, Ausgabe 08/2007